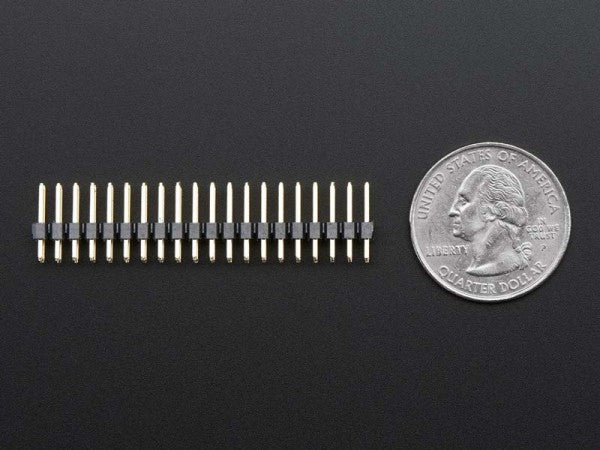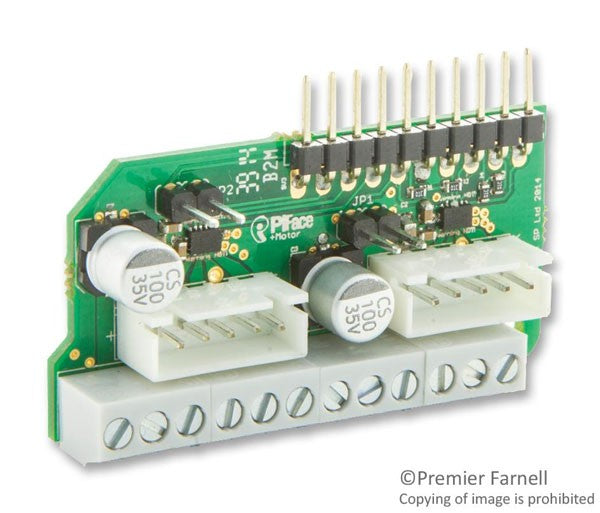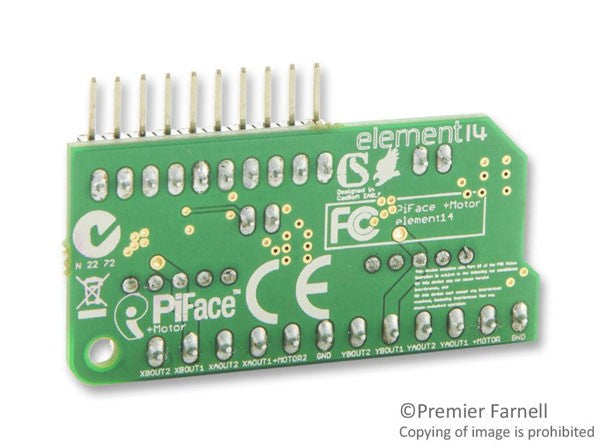Raspberry Pi – der wohl beliebteste Einplatinencomputer
3 Produkte
Zeigt 1 - 3 von 3 Produkten
Im Bereich DIY-Elektronik erfreut sich ein Einplatinencomputer (Single Board Computer) besonders großer Beliebtheit: der Raspberry Pi. Ursprünglich wurde der kreditkartengroße Minirechner von der gleichnamigen Firma entwickelt, um Schülern und Studierenden den Umgang mit Hardware und Programmierung näherzubringen, da der Mini-Computer im Vergleich zu einem PC sehr einfach gebaut ist.
Mini-PC mit schier unbegrenzten Möglichkeiten
Weit über seinen Bildungszweck hinaus hat der „Raspi“ längst Einzug in die Bastler-Szene und private Haushalte gehalten und gilt mittlerweile mit mehr als 10 Mio. verkauften Einheiten als Klassiker unter den Einplatinencomputern. Die Gründe für den Erfolg des Raspberry Pi liegen nicht zuletzt in seinen vielseitigen und spannenden Anwendungsmöglichkeiten, ob für eine einfache LED-Matrix, ein NAS (Network Attached Storage) oder ein Multimediacenter mit Betriebssystem – den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Des Weiteren ist der Raspi ein schneller Mikrocontroller, hat einen geringen Stromverbrauch und ist kostengünstig in der Anschaffung.